Inhalte dieser Seite
- 1 Nierenerkrankungen gehören zu den häufigsten Todesursachen
- 2 Die chronische Niereninsuffizienz
- 3 Sinnvolle Vorsorgeuntersuchung
- 4 Die Nierendiät beim Hund
- 5 Kommerzielle Diäten – Trockenfutter, Nassfutter als Nierendiät
- 6 Selbst hergestellte Diäten – BARF
- 7 Nierendiät – Nie wieder Leckerli?
- 8 Wenn der Hund nicht fressen möchte
- 9 Regelmäßige Kontrollen beim Tierarzt
Nierenerkrankungen gehören zu den häufigsten Todesursachen
Nierenerkrankungen, allen voran die chronische Niereninsuffizienz gehört leider zu den häufigsten Erkrankungen des älteren Hundes. Man geht davon aus, dass zwischen 2 und 5 % der Hunde davon betroffen sind und es somit zu den häufigsten Todesursachen bei älteren Patienten gehört.
Das fatale, die Erkrankung beginnt meistens schleichend und als Hundebesitzer ist sie anfangs überhaupt nicht sichtbar. Erst wenn über 50 % der Nierenfunktion ausgefallen ist, werden Symptome beim Hund sichtbar.
Du siehst, es muss schon sehr viel Nierengewebe „kaputt gehen“ bis der Hund überhaupt sichtbar krank wird.
Die chronische Niereninsuffizienz
Die chronische Niereninsuffizienz (auch CNI abgekürzt) entsteht, wenn gesundes Nierengewebe so geschädigt wird, dass es seine Funktionen im Stoffwechsel nicht mehr wahrnehmen kann.
Die Ursachen der chronischen Niereninsuffizienz sind vielfältig. Es gibt angeborene Erkrankungen und erworbene Niereninsuffizienzen, die als Folge einer anderen Ursache entstehen, z. B. Autoimmunerkrankungen, Gifte, entzündliche Erkrankungen, Infektionskrankheiten (Leptospirose), Medikamente, Tumore, Nierensteine etc.
Die Hauptaufgaben der Nieren sind:
-
-
- Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten (z. B. Harnstoff, Kreatinin, Urate, Phosphate)
- Rückresorption von bestimmten Substanzen, sodass diese nicht oder nur im geringen Maße mit dem Urin ausgeschieden werden (Kohlenhydrate, Aminosäuren, Fettsäuren)
- Ausscheidung und Rückgewinnung von Elektrolyten und Wasser, zur Aufrechterhaltung des Wasser- und Elektrolythaushaltes, sowie dem Säure-Basehaushalt.
- Aktivierung und Inaktivierung von Hormonen sowie Rückgewinnung und Ausscheidung derselben
-
Bei der Behandlung einer chronischen Niereninsuffizienz spielt die Umstellung der Ernährung (Nierendiät) eine essentielle Rolle. Man möchte somit mehrere Ziele erreichen:
Da das Krankheitsbild der chronischen Niereninsuffizienz sehr komplex ist, werde ich dazu nochmal gesondert einen Blogartikel schreiben.
Sinnvolle Vorsorgeuntersuchung
Angesichts dessen, dass viele Hunde im Seniorenalter an einem Nierenleiden erkranken, kann ich allen Senior Besitzern nur raten, im Rahmen eines jährliches Checks die Nierenwerte des Hunde überprüfen zu lassen. So können Veränderungen rasch nachgewiesen werden und falls nötig, frühzeitig mit einer Nierendiät und Therapie gestartet werden. Das wiederum verbesserst die Prognose insgesamt.
Denn wie anfangs beschrieben, zeigen die Hunde erst klinische Symptome, wenn bereits mehr als 50 % des Nierengewebes geschädigt sind.
Ein Hund, der eine Nierendiät erhält, muss diese lebenslang bekommen.
Die Nierendiät beim Hund
Neben einer moderaten Proteinzufuhr ist vor allem die Phosphorreduktion essentiell um die Nieren vor weiteren Schäden zu schützen.
Im Folgenden liste ich Dir die einzelnen Komponenten des Futters auf:
Proteine
Hinsichtlich der Proteinzufuhr gibt es teilweise unterschiedliche Meinungen.
Die meisten Experten halten eine moderate Proteinaufnahme für das Beste, denn je weniger Eiweiß aufgenommen wird, umso weniger Stickstoffverbindungen belasten die Nieren und den Körper.
Darüber hinaus sollte das angebotene Protein hochverdaulich sein.
Gleichzeitig enthält eine eiweißreduzierte Diät weniger Phosphor, da dieser in der Regel an Einweiß gebunden vorliegt.
Es gibt jedoch auch Studien, die zeigen, dass eine eiweißreiche Fütterung nicht unbedingt schlechter ist als eine eiweißarme Diät. So zeigten diese zwei Studien (BOVÉE et al. und FINCO et al.), dass es zu keiner Verschlechterung der klinischen Symptome oder Laborparameter kam trotz eiweißreicher Fütterung.
Man vermutet, dass ein Zusammenhang zwischen dem Stadium der Niereninsuffizienz, dem Grad des Gehaltes an harnpflichtigen Substanzen im Blut (Azotämie) und den Auswirkungen des Proteingehaltes liegt.
Konnten bereits beim Hund harnpflichtige Substanzen im Blut nachgewiesen werden (Azotämie), verschlechtert sich diese und der Gesamtzustand des Hundes unter einer eiweißreichen Fütterung.
Sodass man sagen kann, dass ein moderater Proteingehalt (und bei Hunden mit sehr schlechten Laborwerten deutlich geringe Proteingehalte) angestrebt werden sollten.
Insgesamt sind sich alle Experten einig, dass mit der richtigen Nierendiät, eine Verbesserung der Symptomatik erzielt und das Voranschreiten der Erkrankung verlangsamt wird.
Die Studie KRONFELD(1993) und einige andere bestätigen, dass ein moderater Protein- und Phosphatgehalt die besten Ergebnisse liefern.
Ein extrem niedriger Proteingehalt sollte vermieden werden. Denn so entsteht leicht ein Proteinmangel, was wiederum zum verstärkten Abbau von Muskeln und Gewebe führt. Der Abbau von körpereigenen Proteinen hat zur Folge, dass vermehrt harnpflichtige Substanzen anfallen sowie den Hund insgesamt schwächt.
Mineralstoffe -Phosphor
Ganz essentiell bei der Behandlung einer Niereninsuffizienz ist die Reduktion des Phosphorgehaltes im Futter.
Insgesamt sollte die Phosphoraufnahme sollte nicht über 45 mg/kg KG/ Tag liegen (Quelle: Ernährung des Hundes, Helmut Meyer u. Jürgen Zentek, Aufl. 8)
Phosphor wird mit der Nahrung aufgenommen und im Körper für unzählige Funktionen gebraucht (z. B. Aufbau der Knochen, Zähne, Bausteine für Zellmembranen, DNS etc. ). Im Körper wird nahezu der gesamte Phosphor mit Sauerstoff verbunden und bildet so Phosphat.
Nicht benötigtes Phosphat wird beim gesunden Hund über die Niere ausgeschieden.
Ist dieser Vorgang aber durch eine chronische Niereninsuffizienz gestört, sammeln sich Phosphate im Körper an. Es kommt zu einem Phosphatüberschuss in Kombination mit einem Kalziummangel.
Dies wiederum führt zur Stimulation der Nebenschilddrüse, die vermehrt das Hormon Parathormon (PTH) ausschüttet – man nennt das auch sekundären Hyperparathyreoidismus.
Dieser Vorgang führt letztendlich zu einer Entkalkung der Knochen und zu einer Verkalkung der Nieren, was wiederum die Niere stark schädigt.
Deshalb sollte die Nierendiät des Hundes vor allem phosphorarm sein. Gegebenenfalls kann auch das Zufüttern eines Phosphatbinders nötig sein.
Alle anderen Mineralstoffe sollten entsprechend des Erhaltungsbedarf gefüttert werden.
Wie wirken Phosphatbinder?
Einfach gesagt, sind es Verbindungen, die Phosphor, das mit der Nahrung aufgenommen wird, im Speichel, in der Gallensäure und im Darminhalt binden und so verhindern, dass es im Darm aufgenommen und über die Niere ausgeschieden wird. Das so gebundene Phosphor wird mit dem Kot ausgeschieden.
Der Einsatz eines Phosphatbinders wird dann empfohlen, wenn die phosphorreduzierte Diät alleine nicht ausreicht um den Phosphorgehalt zu senken. Man muss aber beachten, dass hohe Phosphorgehalte den Effekt der Phosphatbindern schmälern. Daher sollte der erste Schritt immer die Phosphorreduktion im Futter selbst sein.
Zusätzlich neutralisieren Phosphatbinder die Magensäure (Antazida) und werden daher gerne als Magenschutz zur symptomatischen Therapie bei Magengeschwüren, Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden eingesetzt.
Folgende Phosphatbinder werden eingesetzt:
Calciumhaltige Phosphatbinder
Diese sind als Calciumcitrat, Calciumcarbonat und Calciumacetat erhältlich und sind frei verkäuflich. Nachteilig ist das sie nicht soviel Phosphor binden können und daher in großen Mengen verfüttert werden müssen.
Als Folge einer Langzeittherapie mit calciumhaltigen Phosphatbindern kann sich eine Hypercalcämie entwickeln. Um die Aufnahme des Calciums über den Darm zu mindern, sollten calciumhaltige Phosphatbinder immer mit den Mahlzeiten verabreicht werden.
Lanthancarbonat
Lanthanverbindungen sind Phosphatbinder der neueren Generation. Das tolle, Lanthane werden kaum aus dem Darm absorbiert und das wenige Lanthan, dass vom Körper aufgenommen wird, wird über die Galle ausgeschieden und umgeht somit die Nieren.
Bei der Anwendung sollte beachtetet werden, dass alle Phosphatbinder für eine optimale Wirkung, gut mit dem Futter vermsicht werden müssen.
Vitamine
Infolge eines vermehrten Ausscheidens wasserlöslicher Vitamine, kann das Zufüttern von B Vitaminen sinnvoll sein.
Bei einer Niereninsuffizienz sollten die B Vitamine um das 2-3 fache des Erhaltungsbedarf substituiert werden.
Vitamin C wird bei Hunden in der Leber hergestellt und eine Zufütterung ist theoretisch nicht erforderlich. Da Vitamin C jedoch auch antioxidative Eigenschaften hat, kann eine Zufütterung für diesen Zweck sinnvoll sein.
Vitamin D wird in der Niere in seine aktive Form (1.25 Dihydroxycholeacalciferol – Calcitriol) umgewandelt. Bei schweren Nierenschäden kann somit diese Umwandlung eingeschränkt sein. In diesen Fällen ist das Verabreichen von Calcitriol sinnvoll.
Omega-3-Fettsäuren
Eine weitere sinnvolle Ergänzung sind langkettige Omega-3-Fettsäuren (EPA und DHA). Sie wirken sich günstig auf Entzündungsprozesse aus, verringern den arteriellen Blutdruck und schützen so die Nieren. Geeignet sind Lachsöle, Fischöle, Verfüttern von Lachs etc.
Alles wichtige zu den Omega-3-Fettsäuren erfährst Du in meinem ausführlichen Bericht zu den verschiedenen Ölen in der Hundeernährung.
Kohlenhydrate/ Faserstoffe
Um die Gesamtmenge der Abfallstoffe (Ammoniak) aus dem Darm zu reduzieren, ist der Einsatz von fermentierbaren Kohlenhydraten (Präbiotika) eine tolle Sache.
-
-
- Die Darmpassage wird beschleunigt,
- wirken als „gutes Bakterienfutter“ und drängen so die schlechten Bakterien zurück
- durch einen sauren pH Wert, wird Ammoniak NH3 zu Ammonium NH4+ umgewandelt und mit dem Kot ausgeschieden
-
Geeignet sind z. B. Laktose, Laktulose oder Pektin
Dafür beginnt man zunächst Laktulose oder Pektin zu zufüttern und steigert die Menge auf 1 g/kg Körpergewicht (Pektin) oder 2 g/kg Körpergewicht (Lactulose). Wenn man zu schnell zu hohe Mengen füttert, kann als Nebenwirkung Durchfall auftreten.
Antioxidantien
Nährstoffe wie Vitamin E, Vitamin C oder Taurin sind wirksame Antioxidantien, die freie Radikale abfangen und neutralisieren.
Aus der Humanmedizin weiß man inzwischen, dass Menschen mit einer Niereninsuffizienz höherem oxidativen Stress ausgesetzt sind und somit vermehrt freie Radikale bilden. Die wiederum Zellschäden verursachen können. Deshalb ist das Zufüttern von Antioxidantien gerade bei Hunden mit Nierenproblemen sinnvoll.
Eine natürliche Quelle für Vitamin E ist z. B. Weizenkeimöl.
Einen hohen Vitamin C Gehalt haben beispielsweise Hagebutten.
Außerdem wirken sich Äpfel, Sellerie, Beerenobst, Goldrute, Birkenblätter etc. positiv aus, da sie bestimmte Pflanzenstoffe enthalten, die antioxidativ wirken.
Meine Produktempfehlungen* für nierenkranke Hunde
Das Hagebuttenpulver und das Wildlachsöl von Lunderland füttere ich schon seit Jahren und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Alle Produkte sind frei von Füllstoffen, was mir besonders gut gefällt. Das Kombipräparat mit B-Vitaminen liefert die wichtigen wasserlöslichen Vitamine, die bei einer Niereninsuffizienz gerne mal verloren gehen und das Ipaktine ist ein gängiger Phophatfänger, den ich zeitweise auch schon gefüttert habe. Wenn Dein Hund Probleme mit zu hohen Phophorwerten hat oder Du zweitweise mehr Proteine füttern musst – ist das eine sinnvolle Ergänzung.
Wasser nicht vergessen
Ganz wichtig bei einer Nierendiät ist, dass der Hund immer ausreichend Wass er zu Verfügung hat. Achte bitte darauf, dass Dein Hund auch trinkt. Du kannst auch das Futter mit Wasser anreichern um so die Flüssigkeitsaufnahme zu steigern.
Kommerzielle Diäten – Trockenfutter, Nassfutter als Nierendiät
Für die Fütterung des Hundes nierenkranken Hundes stehen mittlerweile viele kommerzielle Diäten zur Verfügung.
Als Hundebesitzer sollte man sich diese Futtermittel sehr gut anschauen.
Denn Diätfuttermittel ist nicht gleich Diätfuttermittel.
Es gibt teils erhebliche Schwankungen bei den Protein- oder Phosphatgehalten, sodass ein Vergleich der verschiedenen Angebote sinnvoll ist.
Zur Orientierung: Die Proteinversorgung sollte bei 8-10 g/MJ liegen und die Phosphoraufnahme nicht höher als 45 mg/kg KM/Tag sein. (Quelle: Ernährung des Hundes, Helmut Meyer u. Jürgen Zentek, 8. Auflage)
Selbst hergestellte Diäten – BARF
Alternativ zu einer kommerziell erhältlichen Nierendiät, kannst Du das Futter auch selbst herstellen. Dies ist zwar zwar arbeitsaufwendiger als ein Sack Trockenfutter zu kaufen, bietet Dir aber den Vorteil, dass Du z. B. beim Barfen die Zusammensetzung der einzelnen Zutaten frei wählen kannst.
Hier kommen einige allgemeine Hinweise fürs Barfen:
Bei einer selbst hergestellten Nierendiät sollte darauf geachtet werden, dass neben Eiweißen, auch Kohlenhydrate verfüttert werden.
Als Eiweißquelle eignen sich Milchprodukte, Eier und Fleisch.
Beim Fleisch sollte darauf geachtet werden, dass vor allem fettreiches Fleisch gefüttert wird. Denn dies enthält im Verhältnis zum magerem weniger Phosphor.
Also statt Hühnchenbrust, lieber Huhn mit Haut. Statt mageres Rindfleisch lieber Hackfleisch, Kopffleisch oder durchwachsenes Fleisch. Auch Lachs oder Sahnequark können super eingesetzt werden.
Da Knochen starke Phosphorgehalte aufweisen, sollte bei einem nierenkranken Hund auf eine Knochenfütterung komplett verzichtet werden. Das erforderliche Calcium wird über Eierschalen substituiert.
Ergänzt wird die Ration durch Fette (Pflanzenfett, Fischöl, Rindertalg oder Schweineschmalz), stärkereichen Komponenten (Nudeln, Reis oder Kartoffeln), frischem Obst und Gemüse.
Wenn Mineralstoffe ergänzt werden sollen, sollte darauf geachtet werden, dass kein Phosphor oder nur wenig enthalten ist.
Gegebenenfalls macht der Einsatz eines Phosphatbinders Sinn (Blutbild Kontrolle).
Zusätzlich sollte das Futter mit B-Vitamine (doppelt bis dreifache) und etwas mehr Vitamin D angereichert werden.
Wenn Du Dich dazu entscheidet, selbst für Deinen Hund zu kochen oder zu barfen, solltest Du in jedem Fall einen Ernährungsberater zur Rationsberechnung heranziehen.
Nierendiät – Nie wieder Leckerli?
Wenn du einen nierenkranken Hund hast, muss dieser trotzdem nicht auf seine Leckerli verzichten. Diese kannst Du ganz einfach aus eiweiß- und phosphorarmen Zutaten selber herstellen oder diese im Handel kaufen.
Zum selber machen eignen sich neben Gemüsechips, Speckwürfel, Popcorn oder getrockenes Brot, auch Maiswaffeln oder Käse.
Wenn der Hund nicht fressen möchte
Gerade bei weit fortgeschrittenen Nierenerkrankungen wollen viele Hunde nicht fressen. Sie leiden an Übelkeit und Schleimhautirritationen, da der Harnstoff nicht mehr richtig über die Nieren ausgeschieden werden kann.
Häufig assoziieren die Hunde dann das Futter mit Übelkeit und lehnen es komplett ab.
In diesen Fällen können Barf-Rationen, also eine hausgemachte Alternative eine gute Möglichkeit sein den Hund zum Essen zu überzeugen. Gut geeignet ist das Zugeben von Fett, z. B. in Form von Rindertalg oder Schweineschmalz, denn so wird die Akzeptanz des Futters stark erhöht.
Wichtig ist: Dein Hund muss fressen!
Denn durch die Futterverweigerung greift der Körper auf die eigenen Proteinreserven zurück und produziert so noch mehr Abfallstoffe. Damit beginnt eine negativ verlaufende Spirale, denn dem Hund wird noch übler und er möchte immer weniger fressen.
Somit kann es nötig sein, neben der Akzeptanzerhöhung des Futters auch die Übelkeit symptomatisch zu behandeln um den Kreislauf so zu unterbrechen.
Regelmäßige Kontrollen beim Tierarzt
Bei jedem nierenkranken Hund sind regelmäßige Laboruntersuchungen Pflicht. Nur so lässt sich kontrollieren, ob die Therapie gut verläuft oder ob Änderungen vorgenommen werden müssen.
In welchen Abständen diese Kontrolluntersuchungen vorgenommen werden sollten, hängt von vielen Faktoren wie Schwere der Erkrankung, Veränderungen der Laborparameter etc. ab und sollte individuell mit Deinem Tierarzt verabredet werden.
Du interessierst Dich für Themen zur Hundegesundheit? Dann lies gleich weiter:
-
- Die Verdauung des Hundes – Vom Leckerli bis zum Hundehaufen
- Erfahre warum Öle in der Hundeernährung so wichtig sind
- Dein Hund hat Arthrose? Diese Nahrungsergänzungsmittel können Deinem Hund helfen












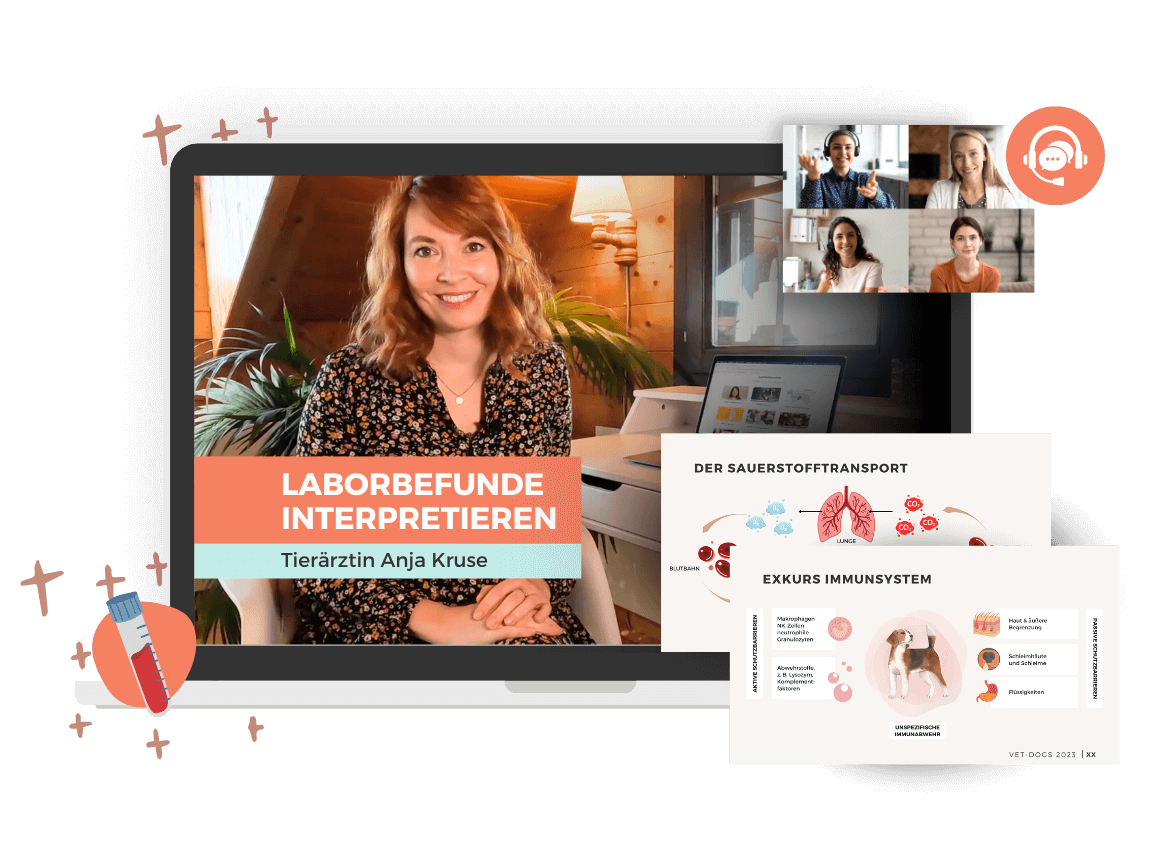
Danke für die wertvollen Tipps!
Super Artikel, mein Labbi hat in den Weinbergen irgendetwas gefressen, was zuerst starken Brechreiz geführt hat. Da er vier Tage später Mundgeruch, leichte Inkontinenz und vermehre Wasseraufnahme entwickelt hat, habe ich eine Blutuntersuchung durchführen lassen.. diese hat dann zu hohe Nierenwerte ergeben. Der TA hat eine Entgiftung mit Detox Tabletten und Spritzen durchgeführt. Da ich barfe habe ich mich informiert um das Futter an die Situation anzupassen und habe die u. a. Kalbsbrustknochen vom Speiseplan gestrichen.
Danke für die Info‘s. Bin auf die Blutuntersuchung nächste Woche gespannt.
Eigentlich wollte ich auch noch ein Barf-Profil erstellen lassen, bin mir aber nicht mehr sicher (ich hab den Beitrag dazu gelesen) ob es wirklich sinnvoll ist.
Hallo Sonja,
vielen Dank für deine Nachricht. Bei euch könnte eine aktue Niereninsuffizienz vorliegen, die – sofern richtig behandelt – gut therapierbar ist, sodass sich auch die Nierenwerte wieder erheblich verbessern. In jedem Fall sollte die Fütterung entsprechend angepasst werden (keine Knochen, Proteine bedarfsdeckend, fettreicher etc.). Ein BARF-Profil ist nicht notwendig. Im Blutbild sollten die Nierenwerte (Harnstoff, Kreatinin, SDMA-Wert) und der Blut-Phosphatwert gepürft werden. Liegen hier Veränderungen vor sollte auch eine Harnuntersuchung gemacht werden. Soll die Fütterung auf Nährstoffe etc. hin geprüft werden, sollte eine Rationsüberprüfung durchgeführt werden.
Ich drücke euch die Daumen, dass die Nierenwerte wieder schnell im Normbereich sind.
Liebe Grüße
Anja
Hallo, mein Hund hat das auch diagnostiziert bekommen. Was darf ich ihm alles füttern? Gibts da eine genaue Auflistung? Ich möchte nichts falsch machen.
Sonja, bezüglich deines Labradors. Wie gehts ihm jetzt? Magst du dich mit mir etwas austauschen?
lg
Hallo Jasmin,
ich würde dir zu einer Ernährungsberatung raten. Im Rahmen dieser Beratung erhältst du einen individuellen Futterplan und natürlich auch konkrete Anleitungen dazu. In Kürze findest du auf unserer Homepage eine Auflistung von Ernährungsberater/innen, die wir ausgebildet haben.
Liebe Grüße
Anja
Mein Hund leidet unter einer Schilddrüsen Erkrankung 1 Wert ist ziehmlich tief unten, und seitdem er Tabletten bekommt ist er wieder sehr agil , und lebensfro allerdings ist er auch ziehmlich Fett und trotz viel Bewegung nimmt er nur schwer ab bis garnicht, nun will ich meinen Hund auch nicht quälen und ständig hungern lassen, .Jetzt kommt noch hinzu das er erhöhte Nierenwerte hat sogar fast um 25 % und ich muss Nierenfutter geben was er nicht frist und von Trockenfutter halte ich nichts also Barfen wäre ne möglichkeit, aber soll ich meinen Hund nun wirklich fettes Fleisch geben ? das kommt mir etwas komisch vor?
Hallo,
wenn dein Hund so große Gewichtsschwankungen hat, solltest du nochmal die Tabletten überprüfen lassen.
Es gibt dann auch noch anderes Nierenfutter (Nassfutter) das akzeptiert dein Hund vielleicht besser.
Liebe Grüße
Ich wollte ein GROßES DANKE da lassen🙂
für Deinen Wertvollen Block. Er hat mir damals als die Gelenke Probleme gemacht haben schon unheimlich viel geholfen und jetzt bei der Nierenproblematik ebenfalls! Unser Buddi hat wieder Appetit🤗 er hat gerade die ganze Schüssel Nierendiätfutter mit Reis und gekochtem Kürbis verschlungen🥳
Herzlichen Dank für die Info zum Thema CNI. Wenn ich am Mittag eine vegetarische Mahlzeit einschiebe, dann brauche ich keinen Phosphatbinder oder? Meine TÄ hat mir Pronefra gegeben und ich will auf Dauer lieber auf natürliche Phosphatbinder umsteigen oder eben keine. LG Sabine
Hallo Sabine,
so pauschal lässt sich das leider nicht beantworten. Zum Beispiel enthält Weizenkleie auch sehr viel Phosphor. Ich würde dir empfehlen, eine Ernährungsberatung zu buchen und dir einen individuellen Futterplan erstellen zu lassen.
Liebe Grüße
Anja
Mein Hündin, 20 kg, 3 – 4 Jahre, hat seit über einem Monat eine Blasenentzündung. Zu Beginn waren Bakterien und Kristalle im Urin, sie hat 14 Tage Antibiotikum bekommen. Wir haben EINE Tube Urocid erhalten und keinen Hinweis darauf, dass wir es nachkaufen und weiter verabreichen müssen. Danach wurde der Urin nicht nochmal untersucht. Wenige Tage nach der Einnahme ging es wider vorn vorn los. Vorher wurde kein Antibiogramm gemacht, so dass das Antibiotikum quasi ins Blaue gegeben wurde.
Der Urin riecht morgens (mittlerweile nun auch schon am Abend) wirklich extrem. Der PH Wert ist extrem hoch. Sie macht morgens und teilwiese abends sehr große Pfützen in die Wohnung, kann den Urin nicht mehr halten. Ich habe nun schon der Tierarzt gewechselt da der letzte “keine Ideen mehr hatte”…. Dort wurde ein Ultraschall gemacht und mir gesagt, es gäbe keine Auffälligkeiten. Auch im dann endlich gemachten Antibiogramm war nichts zu finden, aber das wurde auch genau dann gemacht, als meine Hündin quasi frisch ausgelaufen ist. Gar kein Urin mehr drin war…
Der 2. Tierarzt hat nun im Ultraschall ggf kleinere Steine gesehen. Röntgen unauffällig. Nach über einen Monat haben wir nun das Spezialfutter von Royal Canin urinary s/o sowie die durchgängige Einnahme der Paste Urocid als Aufgabe erhalten und sollen 2-3 Wochen warten. Ich weiß, dass dieses vorgehen normal ist, aber mein Bauch sagt mir, dass irgendetwas nicht stimmt.
Ihre Beswerden werden immer schlimmer, pinkelt morgens und abends, es riecht extrem. Manchmal frage ich mich schon, wo die ganze Flüssigkeit eigentlich herkommt. Die Paste nehmen wir nun durchgehend und das Futter seit 6 Tagen. Der PH Wert geht nicht runter, auch der Geruch verbessert sich nicht. Ich habe das Gefühl, dass keiner uns richtig helfen möchte. Wie sollen sich die Steine bei einem weiterhin so hohem PH Wert auflösen können. Dauert es wirklich so lange, bis das Futter seine Wirkung entfaltet?
Hallo Caroline,
eine pauschale Antwort kann ich dir leider nicht geben. Meine Empfehlung: Suche dir bitte eine gut ausgebildete Ernährungsberater*in und lass deine Ration genau überprüfen, durchrechnen und entsprechend anpassen.
Auf meiner Homepage findest du Hunde-Ernährungsberater*innen, die wir ausgebildet haben (LINK).
Ich drück dir fest die Daumen.
Alles Liebe, Anja
Hallo! Mein 14 jähriger Terrier Rüde hat seit März steigende SDMA Werte. Im Oktober waren wir bei 20. Rest top, Urin auch gut. Nun hat eine Ernährungsberatung alles berechnet und angepasst und Phosphor (wir lassen das Trockenfutter weg, er bekommt das bisherige Dosenfutter und passende Zusätze) stark reduziert. Jetzt pinkelt er immens. Muss nach 2-3 Std raus und steht wirklich 20-25 Sekunden und pinkelt. Wir hatten das schon öfter bei Nierendiäten. Urin war immer ok, Blutwerte auch. Und keiner kann mir sagen, was die Mengen an Urin verursacht….
Arbeitet jetzt die Niere so gut? Könnte es nachlassen, wenn alles durchgespült ist? Soll ich vielleicht doch ein paar Brocken seines Trockenfutters untermischen, welches eigentlich zu viel Phosphor hat. Aber bei dieser Mischung mit der aktuellen Dose hat er nicht so viel gepinkelt. Er tut mir ja auch leid, wenn er solchen Druck hat.
Vielleicht gibt es hier Rat?
Herzliche Grüße, Yvonne
Hallo Yvonne,
leider kann ich das aus der Ferne nicht beurteilen (zB. ob dein Hund auch vermehrt trinkt) und kann mir pauschal auch nicht erklären, warum es an der Nierendiät liegen sollte. Ich würde dir empfehlen, hierzu nochmal deine Haustierarztpraxis aufzusuchen, um nach der Ursache zu suchen (Diabetes mellitus/ insipidus, Hyperkortisolismus etc.), ggf. macht auch ein Trinkprotokoll (Wasser im Futter, zB bei Eigenration nicht vergessen) sinn. Aber das würde ich wirklich mit deiner Tierarztpraxis besprechen.
Alles Gute und liebe Grüße
Anja